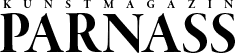Daniel Spoerri

Spoerri lebte in New York, Paris, auf Symi, in Darmstadt, Berlin und Toggwil. Von 1978 bis 1982 lehrte Daniel Spoerri in Köln, wo er mit Studierenden Ausstellungsprojekte und Bankette realisierte, von 1983 bis 1989 war er Professor der Kunstakademie München. 2009 eröffnete Spoerri in einer ehemaligen Poststation in Hadersdorf am Kamp in Niederösterreich das „Kunststaulager Spoerri“. „Die Heimatlosigkeit ist meine Heimat“, so Daniel Spoerri in einem Interview für Ö1. In Wien lebt der Künstler seit 2007. Dort traf ihn die Künstlerin Nives Widauer, seit vielen Jahren mit dem Künstler eng befreundet, zu einem Gespräch am Küchentisch.
NIVES WIDAUER: Du bist 1930 in Rumänien geboren, deine Geburtsstadt Galaţi hat dich unlängst zum Ehrenbürger ernannt.
DANIEL SPOERRI: Ich weiß nicht, wie sie das entdeckt haben, ich bin seit meiner Kindheit nicht mehr dort gewesen. Vor ein paar Jahren wollte ich eine Tour durch Rumänien machen, aber ich habe diese Rundreise panikartig abgebrochen. Die Erinnerungen an die Umstände, die mir und meiner Familie damals widerfahren sind, waren zu viel. In Jassy (Iași) nahe Galaţi, wo ich geboren wurde, haben die Faschisten damals Tausende Juden umgebracht, auch meinen Vater. Meine Mutter war eine Schweizerin. Sie ging als Lehrerin von der Schweiz nach England, sie war irgendwie abenteuerlustig. Von England wurde sie an die englische Schule nach Bukarest vermittelt, dort lernte sie meinen Vater kennen. Er war Jude, ist aber dann zum Protestantismus konvertiert und arbeitete als Missionar für die norwegisch- lutheranische Kirche in Galaţi. Meine Mutter schaffte es, nachher mit uns immerhin sechs Kindern in die Schweiz zu flüchten, zunächst zu ihrer Mutter nach Lausanne, von dort wurden wir auf die Verwandtschaft aufgeteilt. Ich kam zu meinem Onkel Theophil Spoerri nach Zürich. Er war Professor und Rektor der Universität Zürich.
NIVES WIDAUER: Du warst früh sehr selbstständig?
DANIEL SPOERRI:Ich war ein Lausbub, der auf der Straße war, und der alles Mögliche machte. Ich fuhr zum Beispiel mit der Straßenbahn bis zur letzten Station, das war ein Kilometer weit ins Land hinein, dort gab es Bauern, wo ich arbeiten konnte, und am Schluss bekam ich dafür Kartoffeln oder andere Lebensmittel und fuhr damit wieder in die Stadt zurück. Aber die Lebensmittel gab ich nicht etwa zu Hause ab, sondern trug sie wieder zum Markt, um Geld zu haben, um ins Kino gehen zu können. Als Judenkinder waren wir jedoch großer Gefahr ausgesetzt und wurden auf Schritt und Tritt kontrolliert. Ich war aber sehr frech. Ich wusste, dass die Juden beschnitten sind – was ich aber nicht war, weil mein Vater das nicht wollte und meinte, ich solle später selbst entscheiden, ob ich das möchte – und setzte das als Beweis ein. Ebenso übersetzte ich meinen Namen Feinstein auf Rumänisch in „kleines Steinchen“ ( Pietrucica). So schlug ich mich durch, bis wir in die Schweiz flüchteten. Dort musste ich dann leider wieder in die Schule gehen.
Das ganze Interview lesen Sie in unserer PARNASS Ausgabe 01/2021!

DANIEL SPOERRI | Chambre No 13, 1998, Bronze, 2,5 × 3 × 5 m, Fondazione Il Giardino di Daniel Spoerri © Daniel Spoerri und Bildrecht, Wien 2021, Foto: © Susanne Neumann
AUSSTELLUNGEN
Bank Austria Kunstforum
Das Bank Austria Kunstforum Wien widmet dem Künstler im Frühjahr 2021 eine umfassende Retrospektive, die sowohl die Intermedialität des Künstlers als auch die Vielfältigkeit seines Werkes in den Mittelpunkt stellt.
Ausstellungshaus Spoerri
Die Ausstellung »Leben im Mond» im Hadersdorf am Kamp entstand in Zusammenarbeit mit dem »Verein der Freunde des Hauses der Künstler in Gugging« sowie dem Kölner »Kunsthaus Kat18«. Darüber hinaus wählte Daniel Spoerri auch Arbeiten von Art brut-Künstlern aus verschiedenen Privatsammlungen aus. Im Dialog mit einigen seiner eigenen Werken wird es möglich, Daniel Spoerris Berührungspunkte mit der »Art brut« nachzuvollziehen.