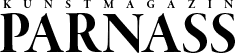In Love with Laura. Ein Geheimnis in Marmor

Zwei Entdeckungen zur farbig gefassten Marmorbüste Francesco Lauranas (um 1430 – 1502) birgt die Kabinettausstellung des Kunsthistorischen Museums „In Love with Laura. Ein Geheimnis in Marmor“ mit Blick auf eine rätselhafte Gruppe von Frauenköpfen, die der aus Zadar gebürtige und in Neapel und in Avignon bei den Anjou tätige Frührenaissancebildhauer zwischen 1465 und 1485 geschaffen hat.
Erzherzog Leopold Wilhelm kaufte die unbekannte Schöne für die Kunstkammer, wohl aus England, Genaueres zur Herkunft ist nicht überliefert. Zum Vergleich sind zwei Marmorbüsten Lauranas aus der Frick Collection in New York als hochkarätige Leihgaben gekommen, wobei die eine, idealisierende, der Wiener schwesterlich nahekommt, die andere als Individualporträt der Beatrice von Aragon mit Namensschild ausgewiesen ist.
Auch im Gesamtvergleich von neun Büsten (weitere aus Paris, Berlin, Washington) bleiben für die schöne Wienerin, die mit ihrem rätselhaft gesenkten Blick vor allem im Fin-de-Siècle zu einer Ikone der Femme fatale hochstilisiert wurde, zumindest zwei Deutungen. Sie kann Francesco Petrarcas lebenslanger literarischer Obsession der Laura gewidmet sein – dafür spricht die Nähe zum gemalten Bildnis des Simone-Martini-Umfelds in einer Handschrift der Canzoniere (Florenz, Bibliotheca Laurenziana) und die naturwissenschaftlichen Entdeckungen der Wiener Restauratoren Herbert Reitschuler und Katharina Uhlir (Röntgenfluoreszenzanalyse) von in Wachs aufgesetzten Lorbeerblüten an der goldenen Haube, die im 3D-Mikroskop sichtbar sind. Der Lorbeer ist jedoch auch Teil des Künstlernamens Laurana und somit die Liebe zur Kunst als Selbstreflexion des bildhauerischen Tuns geistvoll und selbstbewusst integriert.
Zu den vielen Namen von Prinzessinnen der Familien von Aragon und Sforza kommt durch Jaenette Kohl nun erweiternd eine neue Theorie: das weibliche Identifikationsporträt mit Petrarcas Laura könnte die zweite Gemahlin Maximilians I., Bianca Maria Sforza (1472 – 1510), inszenieren, die Büste Teil der Hochzeitsgaben gewesen sein. Die weiteren Autoren des Katalogs wie Sebastian Schütze und Fritz Fischer, die Initiatoren der Schau, handeln wie Kurator Konrad Schlegel die wichtigsten Fragen von Inhalt, Sammlungsgeschichte und Faszination im Gipsnachguss für bürgerliche Wohnzimmer vor 1900 ab – die Schau bringt hier einen Nachbau mit Fotos und bösen Karikaturen von abgründigen Engelmacherinnen, die jene Laura-Büste auf der Kommode zeigen. Als Gegenbeispiel einer weniger der schwarzen Mystik verfallenen, viel freier interpretierten Laura, kommt Giorgiones kleines Ölbild der Wiener Gemäldegalerie in Gerhard Veigels Gestaltung zur vielstimmigen Renaissanceinterpretation hinzu.
Kunsthistorisches Museum
Maria-Theresienplatz, 1010 Wien
Österreich