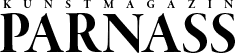81. Whitney-Biennale New York

Die 81. Whitney-Biennale in New York überzeugt wenig, dabei ist ihr Motto doch „Even Better Than the Real Thing“.
Amerika ist sehr unzufrieden mit seiner Kunst
Amerika ist sehr unzufrieden mit seiner Kunst. Zumindest mit der, die aktuell auf der Whitney-Biennale im New Yorker Whitney Museum of American Art gezeigt wird. Sie sei zu risikoarm, zu brav, zu zahm, war in den amerikanischen Kritiken zu lesen. Und in der Tat: Die 81. Biennale, die von jeher den Anspruch hat, ein Spiegel der amerikanischen Kunst zu sein, ist optisch einigermaßen langweilig, höhepunktarm und in weiten Teilen erklärungsbedürftig. Das muss man nicht dem einzelnen Werk anlasten, aber ganz sicher der Auswahl und Zusammenstellung durch das Kuratorenteam Chrissie Iles und Meg Onli. Gezeigt werden die Arbeiten von 71 Künstlerinnen und Künstlern, die wenig Verschiedenes, Widerstreitendes, Gegensätzliches präsentieren. Zu sehen ist, was sich seit langem bewährt hat: Videokunst, Malerei, Fotografie, Textilarbeiten, Installationen, Klangkunst.
Natürlich kann man den Kuratorinnen vorwerfen, sie hätten die „falsche“ Kunst ausgewählt. Doch wenn man sich vorstellt, sie würden die relevante Kunst ihrer Zeit zeigen, dann muss man feststellen, dass diese Künstler sich aktuell vor allem für sich selbst interessieren. So thematisiert Julia Phillips ihre persönliche Erfahrung des Stillens als „Aufteilung der Ressourcen zwischen der stillenden Person und dem Säugling“ und zeigt plastische Körperfragmente wie Mund und Brüste, aus denen Plastikschläuche hängen. Sie werden von wolkig-zarten Brust- und Embryo-Zeichnungen begleitet.

Installation view of Whitney Biennial 2024: Even Better than the Real Thing (Whitney Museum of American Art, New York, March 20–August 11, 2024). Rose B. Simpson, Daughters: Reverence, 2024. Photograph by Audrey Wang
Auch bei P. Staff geht es um eigene Erfahrungen. Es sind die einer Trans-Person, die mit Hilfe eines gelb ausgeleuchteten Raums und einer blau-schwarzen Tapete dargestellt werden sollen. P. Staff will mit dieser Installation auf strukturelle Traumata und strukturelle Gewalt hinweisen, heißt es im Begleittext, ohne den das Anliegen in dekorativer, gelb-leuchtender Belanglosigkeit untergehen würde.

Installation view of Whitney Biennial 2024: Even Better than the Real Thing (Whitney Museum of American Art, New York, March 20–August 11, 2024). P. Staff, Afferent Nerves and A Travers Le Mal, 2023. Photograph by Filip Wolak
Resignation statt Selbstbewusstsein
Mit dieser Diskrepanz zwischen Wollen und Zeigen-Können leben auch viele andere Arbeiten. Etwa die von Harmony Hammond, deren Werk für queer-feministische Themen bekannt ist. Allerdings erinnern die gezeigten Textilarbeiten aus Stoffstreifen und Blutflecken allzu sehr an die abstrakte Kunst des frühen 20. Jahrhunderts und erzählen damit mehr von Resignation als von einem selbstbewussten Statement. Und auch die lebensgroße Figurengruppe von Rose B. Simpsons wendet sich vom Besucher ab und bildet einen Kreis, der in der Ausstellung als „Kraftfeld aus Schutz und Solidarität, das im Gegensatz zu einer instabilen Welt steht“, beschrieben wird. Da erscheint die Möglichkeit, in der Selbsthilfegruppe von Sharon Hayes zu sitzen und dem Gespräch von älteren LGBTQ-Personen aus Los Angeles zuzuhören, schon fast weltzugewandt.
Als Symbol dieser Biennale bleibt letztendlich nur die Arbeit von Kiyan Williams im Gedächtnis, auch wenn es ein künstlerisch ziemlich plattes Symbol ist. Williams zeigt ein verkohltes Weißes Haus in der Pose des Versinkens. Allein die amerikanische Fahne weht unversehrt weiter. Die Installation wird von einer Skulptur, die die gefeierte Trans-Aktivistin Marsha P. Johnson darstellt, betrachtet. Das ist an plakativer Banalität schwer zu überbieten.

Installation view of Whitney Biennial 2024: Even Better Than the Real Thing (Whitney Museum of American Art, New York, March 20- August 11, 2024). From left to right: Carmen Winant, The Last Safe Abortion, 2023; Julia Phillips, Mediator, 2020; Harmony Hammond, Patched, 2022; Harmony Hammond, Black Cross II, 2020-21; Harmony Hammond, Chenille #11, 2020-21. Photograph by Ron Amstutz
Vielleicht ist die diesjährige Biennale nur ein Spiegel der Interessen der beiden Kuratorinnen. Aber vielleicht ist sie auch dieses Jahr ein Spiegel der amerikanischen Künstlerszene, die verunsichert erscheint und sich ins Innerliche zurückgezogen hat. Damit einher geht ein überaus geringes Interesse an neuen Ausdrucksformen und am künstlerischen Experiment.

Installation view of Whitney Biennial 2024: Even Better than the Real Thing (Whitney Museum of American Art, New York, March 20–August 11, 2024). Kiyan Williams, Ruins of Empire II or The Earth Swallows the Master’s House, 2024. Photograph by Audrey Wang
Whitney Museum of American Art
99 Gansevoort Street, 10014 New York
NY
Vereinigte Staaten
81. Whitney Biennale
bis 11. August