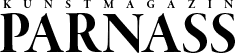Unsterblich werden! Kunstgeschichte schreiben! Und einen Haufen Geld verdienen!

Die Geschichte des Anfangs ist oft erzählt worden: Gerd Harry „Judy“ Lybke, 1961 in Leipzig geboren, war der DDR-Regierung politisch so unbequem, dass er nicht studieren und in keinem sozialistischen Betrieb arbeiten durfte. Daher arbeitete er als Aktmodell an der Kunsthochschule in Leipzig. Nebenbei zeigte er in seiner Wohnung die Kunst seiner Freunde. Da war er Anfang 20. Die erste Ausstellung unter dem Namen „Eigen + Art“ eröffnete am 10. April 1983 – vor 40 Jahren.
Seitdem zeigt er Kunst in seinen Galerien in Leipzig und Berlin und verkauft sie. 2012 wurde in Berlin außerdem das „Eigen + Art LAB“, ein Projektraum für junge Kunst, gegründet. Vor unserem Gespräch hat Lybke einem Sammler die aktuelle Ausstellung „I never look at you from the place“ von Olaf Nicolai in der Berliner Galerie gezeigt, aber vom Kauf des Hauptwerks abgeraten. Die Edition passe einfach besser in die Sammlung, sagte Lybke. Der Sammler, der sich durchaus auch das Hauptwerk hätte leisten können, überlegte, während wir das PARNASS-Interview führten, und kaufte dann die Edition.
PARNASS: Sie leiten heute ein erfolgreiches Unternehmen. Würden Sie noch einmal Galerist werden?
JUDY LYBKE: Bevor „Eigen + Art“ gegründet wurde, war Schauspieler zu werden mein großer Wunsch. Und ich wollte natürlich als Kosmonaut zum Mond fliegen. Beides ging nicht. Heute muss ich sagen, Schauspieler wäre nicht das Richtige gewesen, aber Regisseur wäre ich gern geworden. Ich habe mich 1993 dagegen entschieden.
P: Da gab es die Galerie schon zehn Jahre. Deshalb?
JL: Ich war schon sehr sauer, als ich 1993 durch einen Brief erfuhr, dass ich in der DDR alle Prüfungen, um zu einem Schauspielstudium angenommen zu werden, bestanden hatte. Sowohl an der Schauspielschule in Rostock als auch an den Schauspielschulen in Leipzig und Berlin sowie an der Filmhochschule in Potsdam. Doch ich wurde nirgendwo zugelassen, weil in meiner Kaderakte stand: für ein Studium gesperrt. In dem Brief, den ich 1993 bekam, stand, dass ich zwar rehabilitiert werde, aber nun zu alt bin, um Schauspiel zu studieren. Sie boten mir an, Regie zu studieren – ab sofort. Da musste ich mich entscheiden: Regie studieren, was ich lange wollte, oder in einer Galerie bleiben, die keinen Umsatz macht. Ich lebte auch 1993 noch in der Galerie, schlief auf einem Brett, das ich über die Badewanne gelegt hatte. Ich habe trotzdem entschieden, dass ich mit meinen Freunden weitergehe – zehn Jahre nachdem wir gemeinsam in einer Notsituation angefangen hatten. Das schweißt zusammen.
P: Ebenso wie der Erfolg.
JL: Es dauerte bis 2005, bis die Galerie schwarze Zahlen geschrieben hat hat. Das war schon eine lange Durststrecke. Doch diese Jahre waren – rückblickend – eine Art Wanderjahre. Nicht nur durch die temporären Galerien in Wien, Paris Tokyo, New York, London, sondern weil wir als Gang unterwegs waren. Wir hatten immer viel Spaß – auch in der DDR. Aber wahrscheinlich hätte ich mich sofort für eine Karriere bei der Volksarmee entschieden, wenn ich gewusst hätte, welche Repressalien möglich waren. Schließlich wurde von der Stasi sogar mein Geruch archiviert, um mich im Internierungsfall, der für etwa 100 Leute in Leipzig vorgesehen war, eindeutig identifizieren zu können. Hätte ich das gewusst, hätte ich sofort aufgehört. Aber ich wusste es nicht, also habe ich einfach weitergemacht.
P: Ihre Stasiakte ...
JL: ... umfasst 18 Bände. Ich habe sie freigegeben, damit jeder sich angucken kann, wie unsinnig das eigentlich war. Ich habe viel mehr erwartet. Ich dachte, die Akten sind mein Eckermann. Aber nein, es ist nur belanglos und traurig, was die Stasi aufgeschrieben hat. Manchmal haben wir wirklich etwas Politisches gemacht – selten –, aber die Stasileute haben das dann ein bisschen weniger schlimm beschrieben. Und wenn wir nichts gemacht haben, haben sie ein bisschen dramatisiert. Sie wollten ihre Arbeit behalten. Schließlich waren bei uns alle supersexy und gut drauf und es gab immer Party. Die Tür zu meiner Leipziger Dachwohnung, in der ich für 16 Mark Miete lebte und die ersten Ausstellungen machte, ist auch im Museum „Zeitgeschichtliches Forum“ in Leipzig.
Ich bin kein Künstler, ich mache keine Kunst, ich habe mit Kunst nichts zu tun. Ich bin Unternehmer.
P: Warum die Tür?
JL: Da wurden viele Nachrichten draufgeschrieben, denn es gab ja noch keine Handys. Und das Loch ist zu sehen, das ich in die Tür gesägt habe, nachdem sie mal jemand eingetreten hat.
P: Die Stasi?
JL: Nein, ich hatte immer viel Besuch. Es hatte sich herumgesprochen, dass man bei mir übernachten kann. Manchmal, morgens in der Küche, habe ich mich als der, der dort wohnt, zu erkennen gegeben. Manchmal nicht. Das Loch habe ich reingesägt, damit man sieht, dass nicht abgeschlossen ist.

Gerd Harry Lybke, Foto: Enrico Meyer
P: Nach den wilden Leipziger Anfängen und nach der politischen Wende sind Sie ins Ausland gegangen.
JL: Am Anfang, 1990, hatte ich eine temporäre Ausstellung in einer Galerie in Wien, dann sind wir nach Tokyo gegangen, weil wir dachten: In der Bundesrepublik gibt es genug Galerien, also gehen wir weg. Japan war ein riesiges finanzielles Desaster, Paris 1991 war auch ein Desaster, 1992 hatten wir eine temporäre Galerie in den heutigen Kunstwerken in Berlin, 1993 ging ich nach New York.
P: Sie haben beschrieben, dass Sie bescheiden leben können, aber ohne Geld geht man trotzdem nicht nach New York.
JL: Damals war Rezession in New York, alles stand leer.
P: Aber irgendetwas haben Sie doch verkauft?
JL: Ja, immer mal. So war es auch ganz zu Anfang: Die Teilnahme an der ersten Messe 1990 in Frankfurt am Main kostete 10.000 Westmark. Der Unternehmer Arendt Oetker gab mir einen Kredit, denn das war noch vor der Währungsunion. Ich habe einiges verkauft und konnte den Kredit zurückzahlen und hatte noch Geld übrig. Zurück im Osten habe ich von diesem Geld Kataloge drucken lassen und habe sie verschickt. In dieser Gemeinschaft, die wir waren und sind, hat alles viel Spaß gemacht. Und es macht immer noch Spaß, was man auch daran sieht, dass die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer noch da sind – manche seit 32 Jahren. So wie die Künstlerinnen und Künstler. Das unterscheidet uns auch von anderen Galerien. Bei uns gibt es gegenseitige Akzeptanz und Freundschaft, auch auf professioneller Ebene. Ich habe mit keinem Künstler einen Vertrag, aber wir zahlen sofort, wenn etwas verkauft wird.
P: Geld zu verdienen ist nicht unwichtig für eine Galerie.
JL: Klar. Ich wusste immer, dass Geld dazu da ist, um eine Strecke von A nach B in einem schnelleren Tempo zurückzulegen. Man kann im Kapitalismus, wenn der wirklich existiert, mit Geld etwas anfangen. Klar kann man sich ein dickes Auto kaufen. Man kann aber auch in eine Idee investieren. Ich war damals nach der Wende hungrig auf alles. Ich wollte natürlich keine Schokolade oder irgendetwas kaufen. Ich hatte Hunger danach, mich auszubreiten. Ich hatte Hunger danach, etwas aus meinem Leben zu machen, meine Visionen umzusetzen.
P: Welche waren das?
JL: Unsterblich werden! Kunstgeschichte schreiben! Und einen Haufen Geld verdienen – das ist doch ganz klar! Und mit diesem Geld wieder unsterblich zu werden und Kunstgeschichte ui schreiben! Du musst nicht aufstehen, wenn du das nicht willst. Man analysiert den Markt nicht und rennt ihm dann hinterher. Man MACHT den Markt! Oder mit den Worten von Bertolt Brecht: Was ist der Einbruch in eine Bank gegen die Gründung einer Bank? Man muss Dinge so bringen, dass die Leute sie brauchen wollen.
P: Wann interessiert Sie ein Künstler?
JL: Es geht nicht darum, ob ich ein Kunstwerk gut oder schlecht finde.
P: Nicht?
JL: Nein! Nein, es geht um die Person. Denkt sie in die Richtung, in die sie arbeitet? Hat sie eine spezielle Sicht auf die Dinge, hat sie eine Mission? Und folgt sie ihr ohne Wenn und Aber. Schafft sie es, im Werk zu bleiben, auch wenn sie Erfolg hat? Dann kann man so etwas durchsetzen. Dann investiere ich in die Karriere.

Galerie Eigen + Art, Berlin, Foto: Uwe Walter, Berlin
P: Eine Galerie lebt vom Verkauf ...
JL: Natürlich! Ich bin kein Künstler, ich mache keine Kunst, ich habe mit Kunst nichts zu tun. Ich bin Unternehmer. Ich habe eine Obhutspflicht gegenüber den Künstlerinnen und Künstlern, dass sie Zeit für ihre Kreativität haben und von dem, was sie machen, leben können. Und wenn sie das nicht machen können, weil ihre Kunst sich nicht zum Verkauf eignet, dann sorgt man dafür, dass sich der Künstler auf eine Professur bewirbt – und irgendwann klappt es.
P: Als Sie anfingen, gab es keinen Markt für gegenständliche Malerei.
JL: Am Anfang waren wir für Konzeptkunst bekannt. Auf der documenta X 1997 haben wir Christine Hill, Jana Milev, Olaf Nicolai, Carsten Nicolai, Jörg Herold gezeigt. Malerei wurde nicht ausgestellt. 2002 zeigten wir das einzige figürliche Bild auf der ganzen Armory Show: „Orter“ von Neo Rauch. Die Korrespondentin der New York Times, Roberta Smith, stand vor diesem Bild und es schien, als wäre ihr das peinlich, als wollte sie nicht dabei gesehen werden. Ich wusste zwar nicht, wer sie ist, aber ich habe ihr ein Dia von der Arbeit gegeben – digitale Fotos gab es damals noch nicht. Es wurde in der New York Times gedruckt. Danach ging es los. Und dann hat Neo Rauch für alle Malerinnen und Maler auf der ganzen Welt die Tür zur gegenständlichen Malerei aufgemacht – das hat sonst niemand gewagt.
P: Gibt es Vergleichbares von anderen Künstlern der Galerie?
JL: Nein. Aber es gibt andere grandiose Sachen. Carsten Nicolai hat ein Plattenlabel und ist Musiker (Alva Noto), Komponist und bildender Künstler und hat zum Beispiel 2015 für den Film „The Revenant“ mit dem gerade verstorbenen Musiker Ryūichi Sakamoto die Filmmusik gemacht. In der Elbphilharmonie hat er letztens ein großes Konzert gegeben. Diese Doppelkarriere gibt es, weil wir keinen Künstler und keine Künstlerin einschränken.
P: Und keinen antreiben.
JL: Das sowieso nicht.
P: Sie haben beschrieben, wie ein Künstler sein muss, um ihr Interesse zu wecken. Kann er oder sie das auch wieder verspielen?
JL: Wir als Galerie können das bestimmt. Aber letztendlich haben ganz wenige die Galerie wieder verlassen. Manchmal geht es eben zu Ende. Und manche Dinge haben sich auserzählt. Auch die Liebe erzählt sich manchmal aus. So ist es. Liebe ist überhaupt grundsätzlich mit das Wichtigste. Und dass man sich etwas zutraut und den anderen traut, das ist wichtig.
P: Das beschreibt das Verhältnis zwischen Galerie und Künstlern sehr schön.
JL: Ja, aber auch zwischen den Mitarbeitenden der Galerie. Wir sind 25 feste Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Über die Hälfte sind seit über zehn Jahren dabei. Kerstin Wahala und Elke Hannemann waren die Ersten, die vor über 30 Jahren dazukamen, mit ihnen hat sich die Galerie professionalisiert. Zuvor war es eine Freundesgruppe, die mitgeholfen hat. Wenn die beiden nicht bei mir als Mitarbeiterinnen angefangen hätten, wäre es nicht weitergegangen. Die Investition in die Menschen war wichtig. Und die haben wieder Leute geholt und so wurden es immer mehr und jeder hat eine bestimmte Aufgabe. Wir sind ein Team, aber letztendlich entscheidet jeder auf seinem Gebiet. Und ganz zum Schluss entscheidet der Künstler oder die Künstlerin. Am Ende wird es so gemacht, wie sie das wollen.
P: Welche Kunst interessiert Sie persönlich am meisten?
JL: Ich interessiere mich für die Kunst des Weglassens, indem ich auch zu Hause keine Kunst habe, mich davon befreie, um mich wieder neu auffüllen zu können.
P: Gibt es Veränderungen auf dem Kunstmarkt, die Sie momentan beobachten?
JL: 1993 gab es die Veränderung, dass Fotografen keine Handwerker, sondern Künstler sind. Dann wurde Video Kunst, dann kam Performance, dann kurz Skulptur, dann kamen die Kunst-Schulen, dann kam das Interesse für China, dann für afrikanische Künstlerinnen und Künstler. Wenn man sich da Gedanken machen wollte, kommt man in die Situation, dass man dem Markt hinterherrennt. Wenn man eine Galerie hat, muss man schauen, was die Künstler in ihren Ateliers machen, was es da für Entwicklungen gibt. Die muss man zeigen.

EIGEN + ART Lab, Foto: Uwe Walter, Berlin
P: Sie sind seit 40 Jahren Galerist. Wie muss man sein, um Erfolg zu haben?
JL: Man darf nicht auf den Bahnsteig gehen, alle seine Weggefährten aus seiner Generation in den Zug einladen und Richtung Museen fahren. Man muss immer schön auf dem Bahnsteig bleiben und sehen, dass man alle Züge, die da ankommen, zu jeder Zeit mit Künstlerinnen und Künstlern bestückt und versucht, ihnen den Einlass freizumachen. Dazu braucht man ein relativ großes Samuraischwert, um andere abzuhalten. Viele ältere Galerien sind froh, dass sie den Zug geschafft haben und Richtung Museum fahren. Das ist uns nicht genug. Auch für die Künstler und Künstlerinnen, die jetzt in den Museen sind, kann das nicht genug sein.
Leipzig ist eine Stadt, die einen braucht. Wenn du dort etwas machst, dann siehst du deine Fußabdrücke.
P: „Eigen + Art“ hat Standorte in Berlin und Leipzig. Warum haben Sie Leipzig als Galeriestandort nie aufgegeben?
JL: Leipzig ist einfach eine sehr lebendige Stadt mit vielen verschiedenen Künstlerszenen: Schauspiel, Kunst Musik, Tanz, Museologie. Die Stadt ist groß genug, um in einer Nische zu arbeiten und klein genug, dass man sich immer wieder begegnet. Und Leipzig ist eine Stadt, die einen braucht. Wenn du dort etwas machst, dann siehst du deine Fußabdrücke. Berlin braucht dich nicht. Berlin frisst dich, nimmt dich, verwertet dich. In New York ist es ähnlich, da könnte man nur mehr Geld verdienen. In Leipzig ist es eine noch hungrige Szene und es ist sehr gut sichtbar, was man macht. Das ist grandios! Und das ist es, was mir am meisten Spaß macht: etwas bewirken zu können.
P: Verkaufen macht Ihnen Spaß?
JL: Ich liebe die Menschen! Und ich habe sonst gar keine Gelegenheit, so tief und nah mit all diesen Leben zusammenzukommen. Ich begeistere gern Menschen. Jemand möchte etwas haben und ich gebe es gern auf, damit es an einem neuen Ort neue Energie entwickelt und für den Künstler oder die Künstlerin spricht. Dann nehme ich auch das Geld gern an, gebe die eine Hälfte an den Künstler und investiere die andere Hälfte. Verkaufen macht aber auch dem Sales-Team der Galerie Spaß. Es gibt viele jüngere Sammlerinnen und Sammler, die die Kunst ihrer Generation sammeln und von gleichaltrigen Galerie-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern beraten werden. Ich bin nicht der Flaschenhals der Galerie, durch den alle durchmüssen. Wenn man bei mir persönlich kaufen will, bekommt man keinen Rabatt.

Galerie Eigen + Art, Spinnerei, Leipzig, Foto: Uwe Walter, Berlin
P: Bei den anderen schon?
JL: Das entscheidet jeder selbst. Ich gebe keinen Rabatt. Dafür kann man sagen, man habe bei mir persönlich gekauft.
P: Gab es je eine Zeit, wo sie aufhören wollten?
JL: Nein, die Galerie kann entsprechend ihrem Namen „Eigen + Art“ immer weitergeführt werden. Jeder ist „Eigen + Art“. Sie muss dynamisch bleiben können. Sie kann auch etwas anderes werden.
P: Das könnten Sie ertragen?
JL: Im „EIGEN + ART Lab“ ist es schon so. Zu unserer Unternehmenskultur gehört, dass die Abteilungen ihre Entscheidungen selbst treffen – ohne dass ich das letzte Wort hätte.
P: Wie kam es eigentlich zum Namen der Galerie?
JL: In der DDR war es verboten, eine Galerie zu eröffnen. Daher durfte im Namen das Wort Galerie nicht auftauchen, denn darauf stand Gefängnis. Deshalb heißt sie eigen plus art, denn nur Eingeweihte wussten damals, dass „art“ Kunst heißt. Außerdem kann man „Eigen + Art“ auch als Eigenart lesen.
P: Wie lange werden Sie noch Galerist sein? Haben Sie sich eine Grenze gesetzt?
JL: Naja, ich sehe manchmal auf Messen sehr gebrechliche Galeristinnen und Galeristen. Das finde ich ungerecht gegenüber denen, die die Galerie weiterführen. So lange ich lustig umherhüpfe, bin ich dabei. Ansonsten hoffe ich, dass die Kolleginnen und Kollegen mir freundlich sagen, wenn ich nicht mehr auf die Messen zu kommen brauche.
P: Also kein Datum?
JL: Nö, was soll ich denn dann machen, ich habe ja nichts gelernt. Modell stehen wird nichts mehr. Aber sagen wir mal so: Ich versuche, nicht mehr so oft hier aufzutauchen, damit die anderen mehr Platz haben. Aber noch bin ich da! Ich verpasse keine Eröffnung und keine Messe.

2023, Team, EIGEN + ART, Foto: Enrico Meyer
Am Ende des Gesprächs sieht Lybke ein Paar etwas unschlüssig vor der Galerie stehen. Er spricht sie sofort an und lädt sie ein, in die Galerie zu kommen. Sie sind erstaunt bis irritiert, aber sie folgen seiner Einladung. Manchmal, sagt Lybke, sitze er auch vor der Galerie auf einer kleinen Bank in der Sonne und dann „quatsche ich die Leute an, die vorbeikommen“.