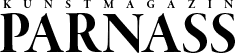3 Shooting Stars

Die Bandbreite der interessanten Künstler mit afrikanischen Wurzeln ist groß und umfasst neben den in der Kunsthalle Krems präsenten Künstler eine Reihe an interessanten Positionen. Für viele von ihnen ist Paris Lebens- und Arbeitsmittelpunkt geworden. Unser Autor J. Emil Sennewald hat zwei von ihnen im Atelier besucht. Die tansanische Künstlerin Sungi Mlengeya haben wir anlässlich ihrer Ausstellung in der Birgit Lauda Art Foundation (B.LA) in Wien getroffen.
Es sind Bilder zwischen Selbstfindung und Ermächtigung.
Sungi Mlengeya
Sungi Mlengeya (*1991 Daressalam, Tansania) wuchs im Serengeti-Nationalpark auf, wo ihre Eltern als Tierärzte arbeiteten. Heute lebt die Künstlerin in Kampala, Uganda. Im Sommer 2022 war sie im Rahmen des Projektes „Women without Borders“ mit einer Einzelausstellung bei der B.LA Art Foundation in Wien zu Gast. Mit einer prägnanten Formensprache setzt sie unter Verwendung des negativen Raums dunkle Figuren in minimalen Schwarz- und Brauntönen vor vollkommen weiße Hintergründe. Ihre Bilder zeigen oft Frauen in Bewegung, die akrobatische Posen einnehmen. „Ich arbeite mit Modellen, mit Frauen aus Tansania und Uganda, Menschen, die mir vertraut sind. Sie bewegen sich, tanzen, posieren und ich fotografiere sie. Diese Fotos bilden dann die Ausgangsbasis meiner Bilder. Es sind Bilder zwischen Selbstfindung und Ermächtigung“, so die Künstlerin in einem Statement für die bedeutende Rolle der Frauen in der Gesellschaft. Der Tanz ist dabei auch ein Ausdrucksmittel für Freiheit und Selbstermächtigung. Sich von der Gestaltung des Hintergrundes zu lösen, war, so erzählt die Künstlerin, eine befreiende Entscheidung, formal und inhaltlich.

Copyright: print right by the artist and B.LA
Toyin Ojih Odutola
In diesen Gesichtern ist Schwarz die Farbe bunter Schattierungen. In diesen Porträts pulsiert Erlebtes in schillernden Windungen, leuchtet durch die Haut. Manchmal wirkt es, als wühlten sich ihre Figuren wie Oscar Wildes Dorian Gray aus einem Madenhaufen aus gestricheltem Fleisch: „The Treatment“ nannte sie das Ensemble von 43 ab 2015 angefertigten Zeichnungen, in denen sie „weiße Männer in ihrer Jugend“ so porträtierte, dass die schwarzen Gesichter wie Negativbilder erscheinen. Spätestens da war klar: Die 1985 in Nigeria geborene, in Alabama, USA aufgewachsene und am California College of the Arts ausgebildete Künstlerin Toyin Ojih Odutola geht dem Körper zeichnend auf den Grund. In den Spurrillen der Bilder grabend findet sie, was beseelt. Seit 2007 werden ihre Werke gezeigt, inzwischen international als neue selbstbewusste „schwarze Porträtmalerei“ gefeiert. Doch das greift zu kurz: Schwarze Personen sollen heute zugleich eine Gemeinschaft und deren Geschichte repräsentieren. Produktiv und mediengewandt geht Odutola dieser Erwartung entgegen.

Toyin Ojih Odutola, Your Face is a Love Letter (Adeseun), 2021–22; © Toyin Ojih Odutola; courtesy the artist and Jack Shainman Gallery, New York
Ymane Chabi-Gara
Sucht man in der französischen Wikipedia nach „Hikikomori“, erscheint ein Foto, das eine mit diesem Ausdruck bezeichnete Person darstellt, die freiwillig niemals ihr Zimmer verlässt. 230.000 solch psychosozialer Einsiedler zählte Japan vor zwölf Jahren, ist zu lesen. Dieser hier hält in der Hocke ein schwarzes Katana über die Knie, schaut in die Kamera. Den Internet-Fund malte 2020 die damals 34-jährige Ymane Chabi-Gara als „Hikkomori 3“. Allerdings ist bei ihr das Gesicht durch violette Haare verdeckt. „Ich verstehe Gesichter nicht. Ihren Ausdruck, aber auch nicht die Zeichen, die man in ihnen sehen können soll“, schreibt Chabi-Gara in einem genau beobachtenden Beitrag zu Alice Neel. Das frisch bei ER Publishing, erschienene kleine blaue Bändchen mit dem Titel „Transatlantique – Alice Neel, mit Beiträgen unter anderem von Ymane Chabi-Gara, Nina Childress, leuchtet in der Herbstsonne auf ihrem Schreibtisch. Daneben finden sich auf der Fensterbank Kataloge zu Oskar Schlemmer, David Hockney. Sie nenne nicht gern Referenz-Künstler, sagt Chabi-Gara in ihrem nagelneuen Atelier im Pariser Vorort Montreuil, sie sei von vielen kulturellen Bezügen beeinflusst: „Ich folge der Bildkultur des Internet, bin aber nicht abhängig von ihr.“ Entspannt, klar, geerdet spricht sie davon, wie wichtig es sei, Künstler auf die Realität vorzubereiten, „zum Beispiel die Steuererklärung zu machen“. Sie bewundere engagierte Kunst, verachte jedoch „instagrammatische“ Show-Aufregungen und isolierende Ideologien. „Für mich ist wichtiger zu fragen: Was machst du wirklich, was tust du konkret?“

© Ymane Chabi‑Gara, Adagp, Paris, 2022. Photo. DR. Courtesy the artist and kamel mennour, Paris