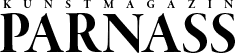Oswald Oberhuber 1931–2020

Mit Oswald Oberhuber ist einer der wichtigsten Protagonisten der österreichischen Kunstgeschichte gestorben. PARNASS traf Oberhuber 2016 anlässlich seiner Retrospektive im 21er Haus zum Gespräch. Unser Interview zum Nachlesen:
Wer die Ausstellung von Oswald Oberhuber im Wiener 21er Haus betritt, fühlt sich an manchen Stellen, als würde er nicht die Schau eines 85-Jährigen, sondern eines viel jüngeren Künstlers besichtigen. Seine „Gerümpelplastiken“ etwa, die aus dem Informel kamen und mit denen er in den 1940er-Jahren begann, könnten genauso gut im 21. Jahrhundert entstanden sein. Oberhuber stand künstlerischen Dogmen stets fern – bloß künstlerisch stehenzubleiben, als Marke erkennbar werden, das wollte er nie. „Sich stets einer Festlegung und Kategorisierung entziehend, setzt sich Oberhuber frei von Berührungsängsten mit verschiedensten künstlerischen Entwicklungen auseinander, entdeckt und erfindet, experimentiert und assimiliert, um das jeweilige Potenzial auszuschöpfen bis zum nächsten Neuen“, schreiben die Kuratoren Luisa Ziaja und Alfred Weidinger im Ausstellungskatalog. Und so ist das Werk des gebürtigen Meraners, der zunächst in Innsbruck, danach in Wien studierte, eine heitere Mischung aus informellen Skulpturen und Malereien, konzeptuellen Collagen, politischen Plakaten, großformatigen, fast hyperrealistischen Gemälden, psychedelisch-ornamentalen Kompositionen, geometrisch-reduzierter Plastik, schrägen Kostümentwürfen und vielem mehr. Als Rektor der Hochschule (heute: Universität) für angewandte Kunst und Leiter der Galerie nächst St. Stephan war er darüber hinaus stets rühriger Kunstvermittler. Oberhuber lebt nahe dem Belvedere, in einer hellen Dachgeschosswohnung. Dort sprach PARNASS mit ihm.
PARNASS: Herr Oberhuber, Sie machen seit den 1950er-Jahren Kunst. Was meinen Sie: Hätten Sie es heute als junger Künstler schwieriger als damals? OSWALD OBERHUBER: Ich denke schon. Wobei ich damit nicht sagen möchte, dass es wir Ältere leicht hatten. Aber die Konkurrenz war eben kleiner. Heute braucht es länger, dass sich einer durchsetzt. Das hängt mit den Institutionen zusammen. Es gibt viele Galerien, aber sie machen zu wenig.
P: Sehen Sie das wirklich so? Die Galerien selbst würden das bestreiten. OO: Ja, aber meine Erfahrung ist ganz anders. Man muss junge Künstler ins Ausland bringen. Es ist ja kein Problem, einen Raum aufzumachen, Bilder hinzuhängen, Skulpturen hinzustellen und sie anzubieten. Aber sie hinauszutragen, mit anderen Galerien im Ausland zu arbeiten: Das ist entscheidend.
P: Sie selbst hatten stets, auch wegen Ihrer Tätigkeit als Rektor der Angewandten, eine große Nähe zu jungen Künstlern. Wie ist das denn heute? Gehen Sie beispielsweise zu den Diplomrundgängen auf die Kunstakademien? OO: Das mache ich nicht mehr, aber das hängt mehr mit meinem Alter zusammen. Das ist mir zu anstrengend. In den Füßen bin ich doch richtig behindert, immerhin nicht im Kopf. Aber irgendeinen Schaden muss man ja haben, mit 85 Jahren.
P: Wie war es für Sie, sich für die Ausstellung das ganze Werk, das sich über viele Jahrzehnte spannt, noch einmal zu erschließen? OO: Damit hatte ich nicht so viel zu tun, das haben die Kuratoren und die Direktorin gemacht. Dafür bin ich ihnen dankbar. Ich persönlich war ja immer gegen Retrospektiven, wollte nie eine Übersicht zeigen, weil bei mir diese Übersicht ja auch schwierig ist, da ich ein sprunghafter Mensch bin. Das erschwert so große Ausstellungen. Schließlich konnte mich die Direktorin Agnes Husslein überreden, worüber ich sehr froh bin.

Oswald Oberhuber, Ziege und Schafe, 2009, Öl auf Leinwand, 80 x 80 cm, Belvedere, Wien, Schenkung des Künstlers, Foto © Belvedere, Wien
P: Dieser Pluralismus ist etwas, wofür Sie bekannt sind. Aber in den Porträts lässt sich schon eine Handschrift, ein bestimmter Stil erkennen. OO: Der Begriff ist falsch, es gibt keinen Stil. Das behaupte ich seit den 1950er-Jahren. Dieser Begriff ist nur ein Hebel, um etwas festzuhalten. Ich kann auch beim Kubismus oder Futurismus nicht von einem Stil sprechen, sondern nur von einem Vorgang, der in einem gewissen Kulturraum entsteht.
P: Sie selbst studierten bei Fritz Wotruba. Wie hat Sie das geprägt? OO: In Innsbruck habe ich schon zuvor die informelle Skulptur entwickelt, damit begann ich mit 16 Jahren. Als ich zu Wotruba studieren ging, blieb ich nur zwei Tage – denn da hätte ich von vorne anfangen müssen. Schließlich hatte ich schon ein Œuvre von 300 Plastiken! Später war ich dann aber sein Assistent.
P: Stimmt es, dass er sich recht autoritär gab? OO: Autoritär war er nicht, sondern ein wahnsinnig lieber Mensch. Aber er war der Meinung, dass man aus seiner Plastik heraus lernen könne, wie man Skulpturen macht. Das ist völlig falsch! Im Grund muss eine Kunstschule jedem Schüler freie Hand lassen. Das Problem ist, dass die Werke vieler junger Künstler wie jene ihrer Lehrer aussehen. Aber man darf eben nicht so auf die Schüler einwirken, dass man als Lehrer sofort sichtbar wird.
P: Wie kann man das verhindern? OO: Indem man versucht, Lehrer zu berufen, die mehr Freiheit in sich haben, die nicht so fixiert sind auf ihre Aussagen. Man müsste die Professoren viel mehr austauschen, auch viel mehr mit Gästen arbeiten. Als Rektor habe ich das selbst versucht.
P: Es ist ja eine Grundsatzfrage, ob man die Kunst überhaupt lehren kann. OO: Im Grunde kann man das nicht, man kann nur die Leute darauf hinführen. Das Wichtigste ist, dass sie viel Kunst anschauen. Manche Lehrer sagen: Schau ja nichts an, sonst wirst du verdorben. Aber das ist der ärgste Fehler! So verdorben kann gar niemand werden.
P: Ihre eigenen Arbeiten nahmen ja einiges vorweg: Es gibt in der Ausstellung etwa Brandbilder, die an Alberto Burri, Kleinplastiken, die an Isa Genzken denken lassen. Darüber hinaus stellten Sie einmal ein Bett aus – wie viel später Tracey Emin. Wenn Sie sehen, dass später jemand mit etwas reüssiert, das Sie ähnlich schon früher gemacht haben: Wie geht es Ihnen da dabei? OO: Das muss alles nicht von mir angeregt sein. Ich verlasse die Dinge dann gleich wieder. Wobei: Das mit dem Bett hat mich schon geärgert, als diese Engländerin da so einen Erfolg damit hatte. Das sind so gewisse Ungerechtigkeiten.
P: Der Sammler Rudi Schmutz behauptete einmal von Ihnen, dass Sie die Sammlergemeinde polarisierten. Stimmt das denn? OO: Die Sammler, die leidenschaftlich sind, akzeptieren meine Veränderbarkeit, nehmen manchmal aber nur eine bestimmte Linie auf. Aber es ist mir sowieso viel lieber, wenn einer nicht viel kauft, sondern wenn viele Einzelpersonen etwas kaufen.
P: Sie haben schon in den 1950er-Jahren ihr künstlerisches Prinzip der Veränderbarkeit formuliert. Wie kamen Sie bereits als ganz junger Künstler dazu, solch einen programmatischen Text zu schreiben? OO: Entscheidend dafür war die Vorgeschichte, nämlich meine informelle Plastik. Damit hatte ich schon eine gewisse Produktion, in der bereits etwas festgelegt war. Das war zwar eine geschlossene Gruppierung, was nicht ganz meinem System entspricht. Aber es stärkte mich natürlich dabei, durchzuhalten. Die Hauptproblematik als Junger ist, dass man in Depressionen gerät, das Gefühl hat, zu versagen. Das hat jeder! Es ist ein wichtiger Moment, der überwunden werden muss. Daran scheitern viele.
P: Wann war das bei Ihnen der Fall? OO: Immer wieder. Das gehört zum Geschäft. Nur geben es die wenigsten zu. Aber je älter man wird, desto weniger tut es weh.

Oberhuber und Zahlen, 1973 Dispersion auf Molino teilweise collagiert, 209 × 144 cm Belvedere Wien, Schenkung des Künstlers © Belvedere, Wien

Oswald Oberhuber, 1993 Foto © Rudi Molacek